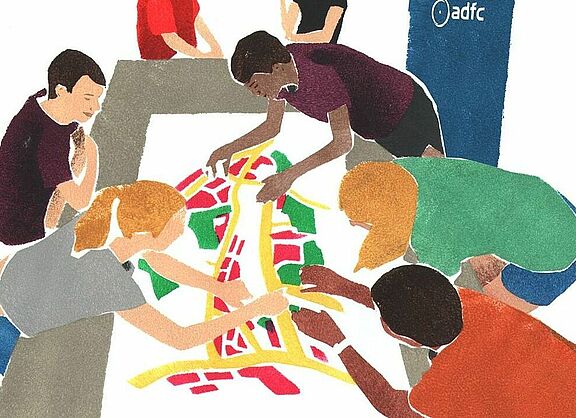Wappen der Landeshauptstadt Stuttgart. © gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=728352
Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Stuttgart
Wer in den Radverkehr investiert, spart langfristig Kosten – hier zu kürzen, ist also nicht nachhaltig. Zumal Stuttgarts Klimaziele und eine Mobilitätswende nur erreichbar sind, wenn die Stadt deutlich stärker aufs Rad setzt. Unsere Stellungnahme.
Stellungnahme des ADFC Stuttgart zum Doppelhaushalt 2026/2027
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nopper,
sehr geehrte Herren Bürgermeister Maier, Pätzold und Thürnau,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
sehr geehrte Damen und Herren im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik,
die Stadt Stuttgart und praktisch alle anderen öffentlichen Aufgabenträger müssen sparen. Dabei ist es wichtig, nicht zu kurz zu denken.
Nicht kurzfristig, sondern nachhaltig sparen – Fördergelder des Landes nutzen
Es macht keinen Sinn, kurzfristige Einsparungen zu erzielen, wenn dies zu hohen Folgekosten führt, die später zu tragen sind. So ist es zum Beispiel in der Verkehrspolitik. Man könnte zunächst meinen, der Umstieg vom MIV (motorisierter Individualverkehr) auf den Umweltverbund könne noch warten, da dies Investitionen in die Infrastruktur erfordert und diese aktuell nicht so einfach zu stemmen sind. Aber das wäre ein sehr kurzsichtiger und gefährlicher Weg. Denn die Folgekosten des Autoverkehrs sind immens, und je weniger es gelingt, die Alternativen zum MIV zu stärken, desto höher werden diese Kosten sein. Das Umweltbundesamt hat die großen Vorteile des Radverkehrs (gegenüber dem MIV) hier dargestellt.
Es ist sowohl für die Verkehrsteilnehmer*innen selber besser, das Rad anstelle des MIV zu nutzen als auch für die ganze Gesellschaft. Einen sehr großen Anteil davon haben die Effekte auf die Gesundheit:
- Radfahren hilft den Radfahrenden gegen Bewegungsmangel
- Weniger Schadstoffe in der Luft für alle, weniger CO2-Ausstoß
- Weniger Lärm für alle
Alles in allem gilt: Radfahren spart Kosten und erhöht gleichzeitig das Wohlbefinden für die Radfahrenden selbst als auch für alle anderen.
Überdies werden die tatsächlichen Kosten der Radinfrastruktur (z.B. Wege, Abstellmöglichkeiten und Wegweisung) für die Stadt Stuttgart oft überschätzt, denn es wird leicht übersehen, dass es für die Maßnahmen aus dem Klimamobilitätsplan hohe Fördergelder durch das Land gibt, mit einem Satz von 75%. Von den im Haushalt zur Verfügung gestellten Beträgen geht also ein Großteil in den allgemeinen Haushalt zurück. Es wäre nicht vernünftig, derartige Förderungen verfallen zu lassen.
Wo sehen wir Möglichkeiten zum Sparen?
Auch beim Radverkehr gibt es Maßnahmen, die sich eher als ineffizient erweisen, wir denken dabei an das RegioRad, welches in Stuttgart nicht den großen Durchbruch erzielen konnte. Das dafür verwendete Geld kann sicher zielgerichteter ausgegeben werden.
Insgesamt sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass durch die Maßnahmen ein möglichst großer verkehrlicher Effekt erzielt werden kann. Es ist besser, mit möglichst einfachen Mitteln viele Projekte umzusetzen als ein „perfektes Leuchtturmprojekt“. Pop-up-Maßnahmen sind dabei ein gutes Mittel; sie können nach ihrer Einrichtung auch für längere Zeit bestehen bleiben und erst dann „verschönert“ werden, wenn sich die finanzielle Situation wieder verbessert hat. Auch die Planung sollte möglichst effizient erfolgen, indem verstärkt Musterlösungen angewendet werden.
Anderweitige Einnahmen erhöhen und nutzen
Anstatt beim Radverkehr zu kürzen, sollte besser dafür gesorgt werden, dass anderweitig Mittel generiert werden.
- Das Anwohnerparken von 30,90 auf 55 Euro/Jahr zu verteuern ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber er geht nicht weit genug. In anderen Städten wurde es bereits deutlich stärker erhöht, in Ulm zum Beispiel auf aktuell 200 Euro, ab Februar 2026 werden es 300 Euro sein.
- Mit einem oder mehreren Scancars – zunächst zur Ahndung von gefährdenden und behindernden Parkvorgängen – ließen sich zusätzlich Einnahmen erzielen und zugleich die Verkehrssicherheit deutlich verbessern. Ähnliches gilt für eine verstärkte Kontrolle von Geschwindigkeiten und Durchfahrverboten.
- Auch eine Nahverkehrsabgabe sollte nun endlich eingeführt werden, möglichst derart, dass die Kfz-Halter einen Beitrag leisten und als Gegenleistung ein ÖPNV-Guthaben erhalten.
Diese Maßnahmen zusammen können uns auch direkt dem Ziel näher bringen, den Modal Split zugunsten des Umweltverbunds zu verändern. Es ist auch nicht schlimm, wenn dadurch die zunächst eingeplanten Mehreinnahmen geringer ausfallen als bei gleichbleibender Kfz-Nutzung anzunehmen wäre. Die Folgekosten des MIV werden dadurch ebenfalls geringer ausfallen – und überdies etwas gerechter zumindest zum Teil von den Verursachern der Kosten getragen.
Überdies sollte festgelegt werden, dass die Investitionsmittel des Bundes aus dem Sondervermögen, sobald sie an die Kommunen weitergereicht werden, in Stuttgart vor allem dem Fuß- und Radverkehr zugute kommen sollen.
Zum Haushaltsentwurf konkret
Laut Ausblick im Fuß- und Radbericht stehen sehr wichtige, bereits geplante Projekte auf der Kippe (siehe Liste im Anhang), andere extrem wichtige Maßnahmen wie zum Beispiel eine Verbesserung der Verbindung zwischen Feuerbach und dem Pragsattel an Tunnel- und Siemensstraße sind anscheinend noch nicht einmal in Planung. Gleichzeitig ist aber von einer Verstetigung der Finanzmittel die Rede.
Die Sparvorschläge des Tiefbauamts sind nicht tragbar, sie gehen einseitig zu Lasten des Fuß- und Radverkehrs. Überdies wurde bereits im Nachtragshaushalt aus dem März 2025 der Etat „Radwege“ für 2025 von 4,0 auf 3,132 Mio. Euro gekürzt.
Fazit
Es ist wichtig, die Mittel für den Radverkehr nicht zu kürzen; diese Mittel werden längerfristig sogar Kosten sparen. Dies gilt sowohl für Sach- als auch für die Personalaufwendungen. Die Wiederbesetzungssperre sollte daher für diesen Bereich auf keinen Fall über den März 2026 hinaus verlängert werden. Neben hohen Folgekosten droht sonst auch der Verfall von Landeszuschüssen und das Nichterreichen der Klimaziele der Stadt Stuttgart. Was im Großen für den gesamten Klimaschutz gilt („Klimaschutz ist zwar teuer, aber kein Klimaschutz ist auf Dauer noch viel teurer“), gilt auch beim Thema Verkehr: Für die Mobilitätswende sind Investitionen erforderlich, aber wenn man diese Investitionen nicht tätigt, sind die Folgekosten noch viel höher. Welche Partei auch immer meint, hier sparen zu müssen, und sei durch eine längere Wiederbesetzungssperre, sollte sich danach nicht mehr als „nachhaltig“ bezeichnen.
Freundliche Grüße
Tobias Willerding
Vorsitzender des ADFC Kreisverbands Stuttgart
Anhang zu den im Fuß- und Radbericht genannten Maßnahmen, deren Umsetzung nicht gesichert ist:
Otto-Konz-Brücken: Wenn die Maßnahme nicht zeitnah wie geplant umgesetzt werden kann, sollte eine Pop-Up-Lösung geprüft werden. Das gilt für beide Richtungen, besonders aber für die Richtung aus Obertürkheim nach Hedelfingen, um zumindest die Zweirichtungsführung auf dem Radweg aufheben zu können. Da es an den meisten Knotenpunkte heute zwei Geradeausspuren gibt, sollte dies sogar möglich sein, ohne die Ampeln von Grund auf umzuprogrammieren – zumindest wenn auf Teilabschnitten auch rechts abbiegender Kfz-Verkehr zugelassen wird, so wie es vor einigen Knotenpunkten der Talstraße der Fall ist.
Knotenpunkte an der Achse durch Bad Cannstatt (RSV 5): Sie sind sehr wichtig, da hier gefährliche Engstellen bestehen. An der Kreuzung Beskidenstraße könnte vorübergehend gegebenenfalls auch ein deutlich vorgezogenes Grün für den Radverkehr aus Fellbach ein wenig Abhilfe schaffen. Da hier eine Pförtnerampel besteht, sollte dies ohnehin selbstverständlich sein – schließlich macht es keinen Sinn, durch solche Maßnahmen den Radverkehr unnötig auszubremsen.
Osterbronnstraße und Pforzheimer Straße: Im Zweifelsfall sollte Tempo 30 vorläufig ohne Umbau eingeführt werden.
Ortsdurchfahrt Botnang: Wichtig sind vor allem die Abschnitte Schumannstraße und Furtwänglerstraße. Sollten auch diese nicht zeitnah umgesetzt werden können, sollten zwischenzeitlich Pop-Up-Lösungen zumindest jeweils bergauf umgesetzt werden.
Möhringer Landstraße, Vaihinger Straße: Sollte dieser Plan nicht zeitnah umgesetzt werden können, sind als Sofortmaßnahmen zumindest eine geradlinige Führung am Abzweig Engstlatter Weg und Nullabsenkungen an allen Knotenpunkten mit Seitenraumführung erforderlich.